Publikation herunterladen
Wandel vollziehen, Bewährtes mitnehmen
Wohnen, Mobilität, Gewerbe, industrielle Produktion, Tourismus, Sicherheit, Gesundheit – in diesen und zahlreichen weiteren Lebensbereichen beeinflusst die Schweizer Baubranche unser Leben Tag für Tag. Sie konzentriert sich fast ausschliesslich auf unser Land. Hier trägt sie rund 15% zum Bruttoinlandprodukt bei. Etwa 330’000 Vollzeitstellen sind im Hoch- und Tiefbau angesiedelt. Das entspricht einem Drittel aller Beschäftigten im industriellen Sektor.
Diese Publikation macht eines überdeutlich: Nur wer differenziert, gewinnt. Gefragt sind Kreativität und Pioniergeist. So steht der Bauindustrie ein Paradigmenwechsel hin zu mehr Differenzierung über vernetztes Zusammenarbeiten bevor. Dazu bietet gerade die Digitalisierung interessante Möglichkeiten. Sie reduziert Schnittstellen, erhöht die Qualität der Plan- und Führungsprozesse und begünstigt die Reduktion von Fehlerkosten und Leerläufen auf dem Bau. Covid-19 dürfte den Abbruch von Silostrukturen in der Baubranche und den anstehenden Umbau rigider Denkmuster antreiben.
Online Live-Event Swissbau Innovation Lab on Tour - Wie wollen wir in Zukunft Gebäude gemeinsam digital planen, bauen und betreiben?
Roland Schegg, Director bei PwC Schweiz spricht über die Schweizer Baubranche am Online Live-Event der Swissbau Innovation Lab.
Expertenpanel
Schweizer Bauakteure sprachen am 26. November 2020 beim Online-Event Swissbau Innovation Lab on Tour über Markt, Digitalisierung und ihre Zukunftsperspektiven vor und seit COVID-19. Weitere Informationen finden Sie unter: Swissbau Innovation Lab.
Referenten:
Roland Schegg (Direktor PwC Schweiz), Markus Weber (Präsident Bauen digital Schweiz / buildingSMART Switzerland), Birgitta Schock (Vorstandsmitglied SIA, Präsidentin SIA-Fachrat «Digitale Transformation») und Hans-Jörg Fankhauser (Architekt & Arealplaner uptownBasel)
Ein- und Ausblick: Was wir aus der Studie schliessen
Von der Komfort- in die Krisenzone
Ein Virus verbreitet Unsicherheit: die Schweizer Baubranche wurde aus einer komfortablen Situation mit vollen Auftragsbüchern in eine Krisenphase mit erheblichen Unsicherheiten katapultiert. Das widerspiegelt sich in der Beurteilung der Zukunftsperspektiven vor und mit Covid-19. Der Optimismus vor Ausbruch der Covid-19-Epidemie lässt sich mit der Tatsache erklären, dass in der Schweiz fleissig gebaut wurde und die Branche bis im Frühjahr 2020 auf Hochtouren lief. Die Umsatz- und EBIT-Erwartungen waren entsprechend positiv und die Hoffnungen in Digitalisierung, Nachhaltigkeit oder systemische Problemlösung gross.

Volumen ja, Margen jein
Covid-19 bringt Ernüchterung: der Vergleich der Einschätzungen vor und seit Covid-19 manifestiert eine klare Abkühlung der Stimmung. Am deutlichsten zeigt sich diese im Tiefbau, im Bereich mit dem höchsten vor Covid-19 geschätzten Umsatzwachstum. Hier reduzieren sich die Wachstumsprognosen von 15% auf 9.5%, also um rund einen Drittel. Diese Beurteilung dürfte in der erwarteten Zurückhaltung und der Tendenz zum Aufschieben der öffentlichen Hand begründet liegen. Allerdings geht der Tiefbau infolge der Lebenszyklen von Infrastrukturen (z. B. Ersatzbauten) weiterhin von Wachstum aus.

Träge wie Beton
Neue Technologien, alte Probleme: die Studienunternehmen halten neben dem gekonnten Umgang mit Covid-19 eine ganzheitliche Problemlösung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und technologische Innovationen wie neue Materialien, Verfahren oder Robotik für die Haupttreiber der Zukunft. Hingegen werten sie den Preiskampf, den Mangel an Differenzierung und eine allfällige Zinswende als Topgefahren. Im Weiteren sehen sie grosse Herausforderungen in der Rekrutierung von qualifizierten Mitarbeitenden. Starre gesetzliche Vorgaben und Baunormen werden ebenfalls eher als Gefahr wahrgenommen.

Hallo Kunde!
Die Einschätzungen der Studienteilnehmenden lassen sich nach Tätigkeitsfeldern und Grösse der Unternehmen auswerten. Diese Betrachtung zeigt einen klar verstärkten Fokus bei der Kundendimension. Interessant sind die unterschiedlichen Prioritäten im Bereich der Leistungserbringung. Hier wollen die Akteure der Projektierung deutlich mehr unternehmen als in den anderen Teilen der Wertschöpfungskette. Insgesamt setzen gerade grössere Unternehmen ihr Augenmerk auf die Leistungserbringung. Sie erwarten sich wertvolle Impulse aus der Digitalisierung und aus dem Einsatz neuer Technologien oder Verfahren.
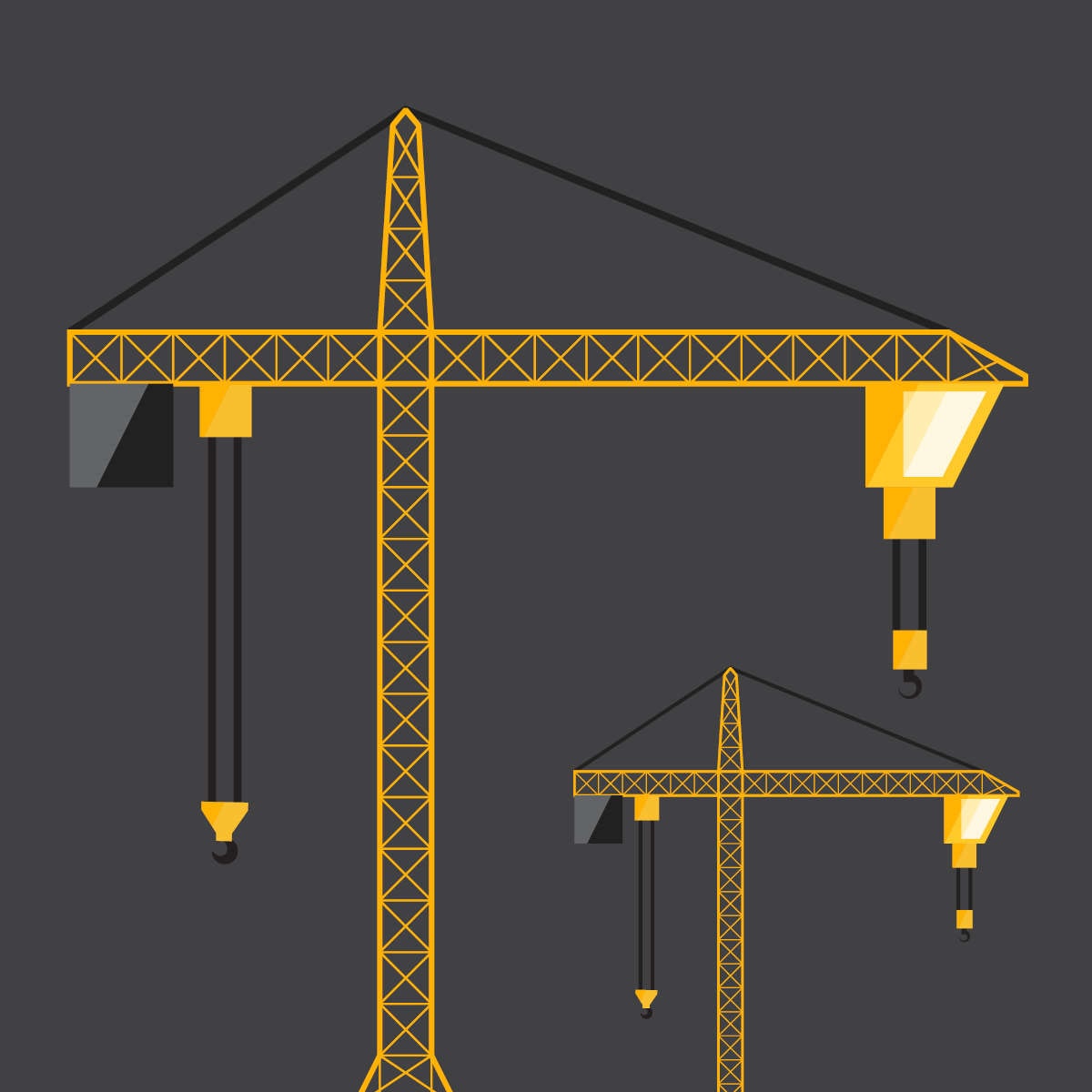
Virtualität wird Realität
Opportunität erkannt: fast neun von zehn Studienteilnehmenden sehen die Digitalisierung vor Covid-19 als Chance. Aber nur rund 60% der Befragten stufen deren heutigen Stellenwert in ihrem Unternehmen als hoch oder sehr hoch ein. Das wirft die Frage auf, ob und warum sich 40% eine Chance entgehen lassen. Die Schere zwischen Chance und Stellenwert vor allem bei kleinen Unternehmen auseinandergeht: Nur gerade 50% der Kleinen messen der Digitalisierung heute einen hohen oder sehr hohen Stellenwert bei. Die Mittleren und Grossen scheinen die Chance ergreifen zu wollen – oder zu können.

Unsere Interviewpartner

Benedikt Koch
Direktor des Schweizerischen Baumeisterverbands (SBV)

Gabriela Schlumpf
Direktorin von Holzbau Schweiz

Luc Frutiger
Mitinhaber und Vertreter der vierten Generation der Frutiger Gruppe

Rico Kaufmann
Geschäftsführer der Kaufmann Oberholzer AG

Markus Weber
Verantwortlicher BIM bei Amstein+Walthert

Matthias Kohler
Professor für Architektur und digitale Fabrikation an der ETH Zürich

Alfred Müller
Verwaltungsratspräsident STUTZ AG
Publikation herunterladen
https://pages.pwc.ch/core-asset-page?asset_id=7014L0000000if4QAA&embed=true&lang=de
Kontaktieren Sie uns

Roland Schegg
Director, Leiter Consulting Familienunternehmen & KMU, PwC Switzerland
Tel.: +41 79 215 29 31






